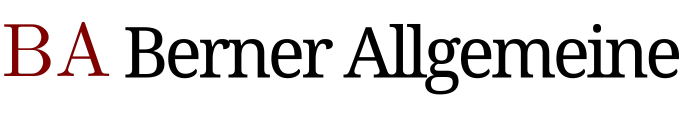Helium ist extrem leicht, reagiert kaum mit anderen Stoffen und steckt in vielen Dingen, die wir täglich benutzen. Doch die Versorgung mit diesem Element ist überraschend anfällig.
Nancy Washton erlebte 2022 einen Schockmoment, als ihre Heliumlieferung unerwartet ausblieb. Ihr Team vom Pacific Northwest National Laboratory in den USA erhielt plötzlich die Nachricht, dass keine Lieferung eintreffen würde.
Der Lieferant erklärte, es gebe schlicht zu wenig Helium – und das Labor müsse nun mit dem Mangel zurechtkommen.
Statt der üblichen 2.500 Liter kamen nur noch deutlich kleinere Mengen an. Im April stand dem Team nicht einmal mehr die Hälfte der benötigten Menge zur Verfügung.
Das Labor betreibt mehrere Geräte, die auf flüssiges Helium angewiesen sind. Um weiterarbeiten zu können, mussten sie einige Geräte abschalten und Prioritäten setzen.
Washton nutzte ein hochmodernes Kernspinresonanz-Spektrometer – das einzige seiner Art in Nordamerika. Das Gerät konnte tief in die molekulare Struktur von Stoffen blicken.
Bereits wenige Monate nach der Installation lieferte es bahnbrechende Ergebnisse. Die Analyse von Magnesiumoxid zeigte, dass dieses Mineral CO₂ aus der Luft ziehen kann.
Solche „Karbonatisierung“ galt als Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel – und nun bestätigten die Daten diese Wirkung eindrucksvoll.
„Wir hatten bei dieser Magnesiumverbindung nie zuvor Karbonate nachgewiesen“, sagt Washton. „Diese Ergebnisse waren unglaublich und erzählten eine starke Geschichte.“
Doch das Spektrometer verbrauchte so viel Helium, dass es abgeschaltet und stillgelegt wurde. Monate blieb es ungenutzt, bis wieder genug Helium zur Verfügung stand. Heute läuft es wieder – aber wie lange noch?
Ein instabiles Versorgungssystem unter globalem Druck
Die meisten Menschen ahnen nicht, wie stark unsere Gesellschaft auf Helium angewiesen ist. Es besitzt die niedrigste Siedetemperatur aller Elemente: –269 °C. Seine Eigenschaften machen es für viele Anwendungen unersetzlich.
In der Raumfahrt kühlt Helium empfindliche Sensoren und reinigt Triebwerke. Raketentreibstoff wird mit Helium verdichtet.
Krankenhäuser nutzen es zur Kühlung der Magnete in MRT-Scannern. Auch Teilchenbeschleuniger wie der am CERN brauchen Helium für ihre supraleitenden Spulen.
Weil Helium so leicht ist, füllen Hersteller Ballons, Luftschiffe und Wettersonden damit. Tiefseetaucher atmen Heliumgemische, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
Die große Knappheit 2022 betraf jedoch nicht nur Labore, sondern auch die medizinische Versorgung, die Halbleiterproduktion und die Luftfahrt.
Rund ein Drittel des weltweiten Heliums verbrauchen Kliniken – vor allem für bildgebende Diagnostik. Auch die Chipindustrie und Automobiltechnik hängen direkt davon ab.
Helium entzündet sich nicht, im Gegensatz zu Wasserstoff. Es bleibt selbst bei extrem tiefen Temperaturen flüssig und friert selbst bei –273 °C nicht ein.
„Helium ist ein einzigartiges Element“, erklärt Chemieprofessorin Sophia Hayes aus St. Louis. Wird es auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt gekühlt, verwandelt es sich in ein Superfluid – eine Flüssigkeit ohne Widerstand.
Bewegt man es, würde es sich theoretisch ewig weiterdrehen. Diese Eigenschaft nutzt der Large Hadron Collider für seine supraleitenden Systeme.
Seit 2006 treten weltweit immer wieder Helium-Engpässe auf. Der letzte große Mangel begann Anfang 2022 – und dauerte Monate.
Obwohl sich die Versorgung später verbesserte, blieb die Situation labil. Fachleute erwarten sogar, dass sich die Nachfrage bis 2035 verdoppelt – wegen Chips, E-Mobilität und Raumfahrt.
Helium entsteht entweder in Sternen oder durch radioaktiven Zerfall in der Erdkruste. Künstlich lässt es sich nicht herstellen. Unternehmen gewinnen es beim Fördern von Erdgas.
Doch nur wenige Konzerne weltweit betreiben solche Anlagen – das erhöht die Abhängigkeit.
Zudem ist Helium extrem flüchtig. Im Superfluid-Zustand entweicht es durch feinste Risse. Einmal freigesetzt, steigt es in die Atmosphäre auf und verschwindet im All.
Diese Eigenschaften machen Helium schwer kontrollierbar – und führen zu regelmäßigen globalen Engpässen.
2022 verschärften gleich mehrere Ereignisse die Krise: Brände in einer russischen Verarbeitungsanlage, Kriegssanktionen, Wartungen in Katar und die Stilllegung der US-Heliumreserve.
Letztere entzog dem Weltmarkt schlagartig 10 % der Produktionskapazität. Innerhalb eines Jahres verdoppelte sich der Preis für Helium.
Auch 2024 blieb die Lage angespannt. Die EU verbot wegen des Kriegs in der Ukraine die Einfuhr russischen Heliums. Gleichzeitig wurde die US-Heliumreserve an den Konzern Messer verkauft.
Fachgremien und Krankenhauslieferanten warnten vor Versorgungsproblemen. Und tatsächlich folgten schon bald gerichtliche Auseinandersetzungen um Betriebslizenzen.
Messer versichert, dass das System stabil arbeitet – doch viele Experten bezweifeln, dass das dauerhaft so bleibt.
Neue Ansätze: Weniger Verbrauch, Recycling und neue Quellen
Wissenschaft, Medizin und Industrie setzen nun auf nachhaltigere Strategien. Im Mittelpunkt stehen dabei MRT-Geräte – große Heliumverbraucher.
Ein herkömmlicher Scanner benötigt rund 2.000 Liter Helium. Fällt das Kühlsystem aus, verdampft das Helium komplett – ein Vorgang namens „Quenching“.
Dabei entweicht das gesamte Gas, die Maschine wird unbrauchbar. Der Schaden ist oft teuer und gravierend.
Neue MRT-Modelle nutzen geschlossene Systeme und benötigen nur rund einen Liter Helium. Diese Geräte stehen bereits in Kliniken und Labors.
Allerdings sind sie teuer – und weltweit sind über 35.000 herkömmliche Geräte im Einsatz. Außerdem erreichen sie nur halbe Magnetstärken von 1,5 Tesla.
„Höhere Feldstärken liefern bessere Bilder“, sagt Sharon Giles vom King’s College London. Für Standardaufnahmen reichen die neuen Scanner aus – für Spezialdiagnosen eher nicht.
Manche Forscher entwickeln Supraleiter, die ohne Helium auskommen. Andere setzen auf Rückgewinnung.
Nicholas Fitzkee von der Mississippi State University installiert ein Rückgewinnungssystem, das 90 % des Heliums wiederverwerten soll.
Die Anlage kostet rund 300.000 US-Dollar – und soll sich innerhalb von sechs Jahren amortisieren.
Doch solche Systeme sind komplex. Washton sagt: „Wenn man 600.000 Dollar für Rohre fordert, verstehen viele nicht den Nutzen.“
Einige Hoffnungen ruhen auf neuen Quellen: In Katar soll bis 2027 ein neues Werk entstehen. In Tansania beginnt 2025 die Förderung eines gezielt entdeckten Heliumfeldes. Auch in China gibt es neue Vorkommen.
Christopher Ballentine von der Universität Oxford war an der Entdeckung in Tansania beteiligt, warnt jedoch: „Solche Projekte brauchen viel Kapital und Vorlaufzeit.“
Die letzten Jahre haben gezeigt, wie schnell die Versorgung zusammenbrechen kann.
Washton bringt es auf den Punkt: „Stellen Sie sich vor, Ihre Großmutter bekommt kein MRT, weil kein Helium mehr verfügbar ist.“
Ihr Appell ist klar: „Wir müssen dieses Problem endlich ernst nehmen.“